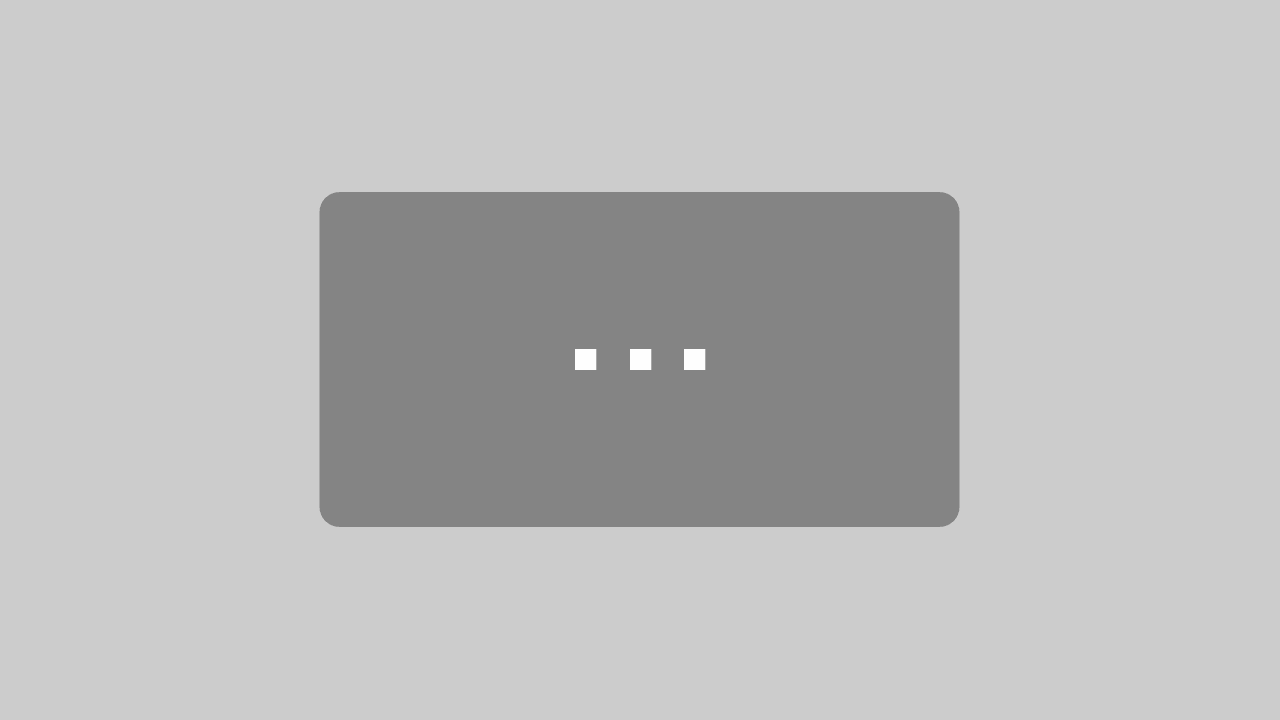Suizid [zuiˈtsiːt], zu lateinisch sui (seiner) und caedere (töten), bedeutet: das Töten seiner selbst. So definiert der Duden den Begriff. Tatsächlich ist es viel mehr als das. Suizidalität ist ein Ausdruck von Hoffnungslosigkeit gegenüber Lebensproblemen oder Krisensituationen, die manchem Menschen unlösbar scheinen. Betroffene sehen keinen anderen Ausweg mehr, als sich das Leben zu nehmen. Am 10. September macht der Welttag der Suizidprävention auf das Thema aufmerksam. Wie sind die Zahlen? Und wie sind Betroffene zu erkennen?
25 Suizidtote täglich
Jährlich sterben allein in Deutschland etwa 10.000 Menschen durch Suizid. Das sind mehr Todesfälle als durch Verkehrsunfälle, jegliche Gewalttaten oder Drogenmissbrauch zusammengenommen. Laut Zahlen des Statistischen Bundesamts (Destatis) wichen die Fallzahlen auch im Jahr 2018 nicht groß ab. 9.396 Menschen – ab dem Teenageralter – wählten den Freitod. Das sind über 25 Personen täglich. Betrachtet man die Statistik, fällt auf, dass überdurchschnittlich Männer (76 Prozent) sich das Leben nahmen. Selbst in den Altersgruppen unter 30 Jahren ist der männliche Anteil deutlich größer. Das Durchschnittsalter ist zum Zeitpunkt des Suizides allerdings höher: Es liegt bei 57,9 Jahren. Suizidale Frauen geben das Leben mit 59,1 Jahren in einem ähnlichen Alter auf. Zudem fällt auf, dass die häufigsten Todesfälle durch Selbstmord sich nicht im tristen, dunklen Herbst ereignen. Vielmehr sind es die Sommermonate Mai und Juli, in denen das gesellschaftliche Leben floriert sowie der Januar.
Hauptursache psychische Erkrankungen
Die Anzahl der Suizide hat sich seit den 1980er Jahren – zu diesem Zeitpunkt nahmen sich noch rund 50 Personen pro Tag das Leben – beinahe halbiert. Dennoch sind 10.000 Menschenleben jährlich ein schlimmer Verlust. Allesamt Menschen, die noch nicht sterben müssten. Was also bewegt so viele Personen dazu, sich für diesen scheinbar einzigen Ausweg zu entscheiden? Die Deutsche Depressionshilfe erklärt, dass 90 Prozent der Verstorbenen an psychiatrischen Erkrankungen litten – hiervon 50 Prozent an Depressionen. Aber nicht nur psychische Krankheiten führen zu suizidalen Gedanken. Partnerschaftskonflikte, Schulden, gesellschaftliche Themen wie Arbeitslosigkeit oder auch chronische, körperliche Erkrankungen können ausschlaggebend sein.
Suizidprävention
Laut Deutscher Depressionshilfe stellt die beste Suizidprävention im Falle psychischer Erkrankungen eine erfolgreiche Behandlung dieser dar. Die Stiftung betreibt zudem ein sehr erfolgreiches 4-Ebenen-Interventionsprogramm. Dieses bindet sowohl Ärzte als auch Angehörige ein. Zunächst allerdings muss der Betroffene sich selbst Hilfe suchen, oder Unterstützung durch das Umfeld zulassen. Doch wie ist jemand zu erkennen, der an Selbstmord denkt? Deutliche Anzeichen sind beispielsweise:
- Merklicher Rückzug aus dem sozialen Umfeld
- Androhung des eigenen Todes
- Gefühle der Wertlosigkeit
- Aggressives Verhalten
- Hoffnungslosigkeit die Zukunft betreffend
Gerade in Zeiten von Isolation und Homeoffice können entsprechende Anzeichen auch im eigenen Bewusstsein schnell untergehen. Wir haben hierzu Strategien für einen gesunden Geist in Quarantäne gesammelt. Bei schlimmen Depressionen finden Betroffene Hilfe bei professionellen Anlaufstellen wie der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention oder der Deutschen Depressionshilfe, die beispielsweise Klinikadressen und einen Notruf bieten.
Prävention als bestes Mittel?
Auch, wenn das Thema Suizid wenig große Präsenz findet und medial meist seltener kommentiert wird als Mord, so ist es doch allgegenwärtig. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die International Association for Suizide Prevention (IASP) setzen daher auf Prävention. Seit 2013 findet jährlich am 10. September der Welttag der Suizidprävention statt, um die Öffentlichkeit auf die weitgehend verdrängte Problematik aufmerksam zu machen. Gerade junge Menschen wollen die Behörden schon früh über depressionsauslösende Ursachen wie zum Beispiel Stress informieren. Neben Aufklärung soll der Tag „Menschen unabhängig von ihrer religiösen Zugehörigkeit einen Raum bieten, in dem der Erfahrung von Verlust und Trauer Ausdruck gegeben und miteinander geteilt werden“, so die Organisatoren.
Titelbild: © ipopba/stock.adobe.com